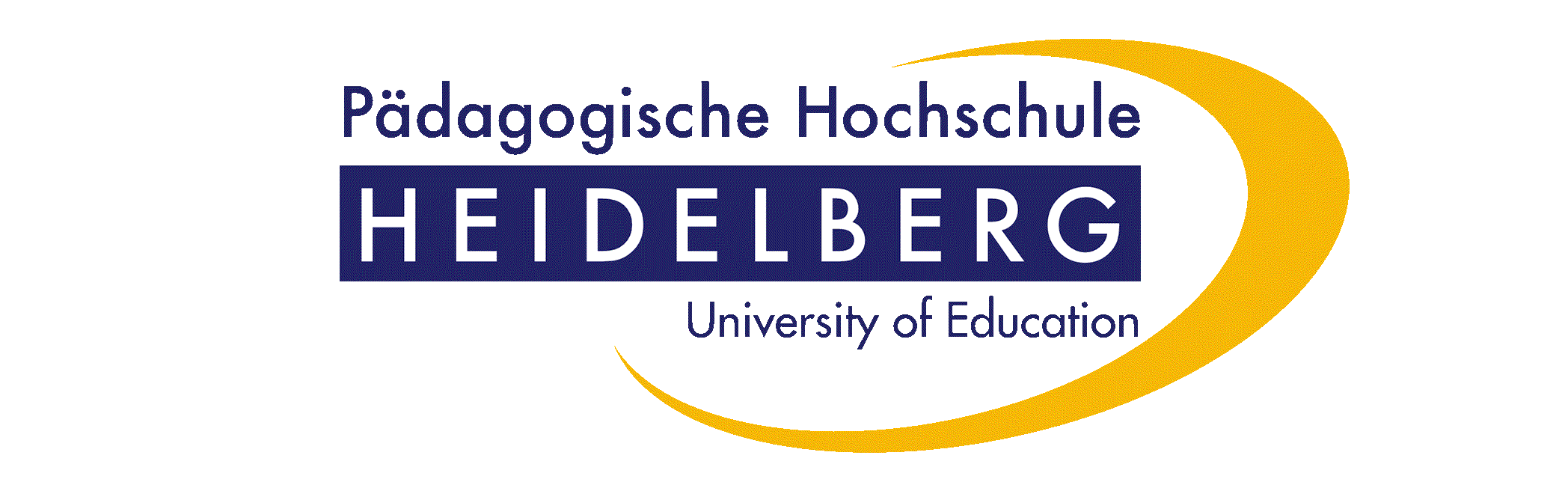Bachelorarbeit
Anna Cap (2025)
Gebärdensprachdolmetschen in der Psychotherapie
Wie kann die Zusammenarbeit von Psychotherapeut:innen und Gebärdensprachdolmetschenden in der ambulanten Psychotherapie gelingen?
Abstract
Diese Arbeit untersucht die Zusammenarbeit von hörenden Gebärdensprachdolmetschenden (GSD) und hörenden Psychotherapeut:innen (PT) in der ambulanten Psychotherapie tauber Patient:innen. Sie soll ein erstes Bild aus der Praxis GSD-gestützter Psychotherapie in Deutschland liefern. Mittels qualitativer Expert:inneninterviews mit drei GSD und zwei PT werden Faktoren identifiziert, die zum Gelingen oder Scheitern der Zusammenarbeit von GSD und PT beitragen. Die Analyse zeigt, dass der Erfolg der Zusammenarbeit maßgeblich von der Übereinstimmung zwischen PT und GSD bezüglich der Rolle der GSD abhängt. Zentral ist dabei die Frage, wie weit GSD in der Psychotherapie aus ihrer neutralen Rolle heraustreten dürfen bzw. müssen. Die Zusammenarbeit scheitert am ehesten dann, wenn GSD sich in therapeutische Entscheidungen einmischen, da dies als Angriff auf die Therapiehoheit der PT verstanden wird. Gleichzeitig sind PT auf Hinweise von GSD zum Dolmetschprozess und zur Gehörlosenkultur angewiesen. Diese Arbeit legt nahe, dass das Bimodal-Bikulturelle Rollenmodell den Erwartungen beider Berufsgruppen am ehesten entspricht, kann dieses Modell aber nicht im vollen Umfang empfehlen, weil viele Fragen zur Neutralität und Allyship oder Emotionalität weiterer Forschung bedürfen. Zudem fehlt die Perspektive tauber Patient:innen auf die Zusammenarbeit von PT und GSD in dieser Arbeit vollständig, weil deren Erschließung im gegebenen Rahmen nicht umsetzbar war. Als zentrale Herausforderung für die Zusammenarbeit erweist sich der Mangel an spezifischen Weiterbildungsangeboten und Leitlinien für das Dolmetschen im Mental Health Bereich in Deutschland, der beide Berufsgruppen zur unvorbereiteten Zusammenarbeit zwingt. Schlimmer noch führen die daraus resultierenden Unsicherheiten und Vorurteile häufig dazu, dass eine Zusammenarbeit von PT grundsätzlich abgelehnt wird. Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass die Zusammenarbeit von GSD und PT erfolgreich sein kann, wenn GSD und PT sich über die Rolle von GSD in der Psychotherapie einig sind, sich lernbereit und offen für das ihnen unbekannte Expertenfeld zeigen und regelmäßig Vor- und Nachbesprechungen halten. Welche Perspektive taube Patient:innen auf diese Absprachen zwischen PT und GSD haben, muss dringend geklärt werden. Die Ergebnisse dieser Arbeit decken sich in umfassender Weise mit internationalen Erfahrungsberichten, zeigen aber im direkten Vergleich auch den enormen Entwicklungsbedarf in Deutschland auf. Es ist ethisch fahrlässig, dass GSD und PT ihre Zusammenarbeit hier nach dem Trial & Error-Prinzip gestalten müssen, weil entsprechende Forschung, Leitlinien und Weiterbildungsangebote fehlen.